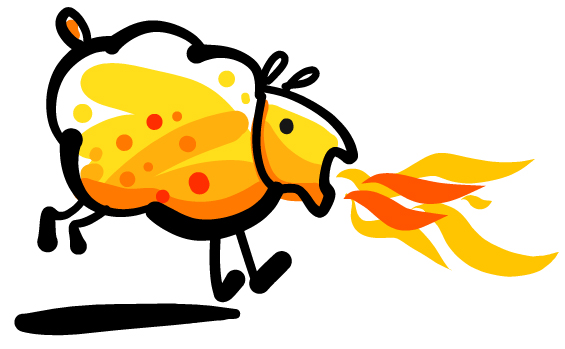Herzlich willkommen! Schön, dass du hierher gefunden hast – zu Kephas, meinem neuen Blog.
Hier geht’s nicht um perfekte Antworten, sondern um echte Fragen. Um das, was einem manchmal frühmorgens beim ersten Kaffee durch den Kopf geht – oder mitten in der Messe, oder beim Hundespaziergang. Um kleine Skizzen, große Gedanken, überraschende Einsichten. Und immer wieder um den Wert der Freundschaft – untereinander und vor allem mit Jesus Christus.
Denn, um es mit Papst Benedikt in seinem Buch »Jesus von Nazareth« zu sagen:
„Am Anfang des Christseins steht nicht eine ethische Entscheidung oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont gibt.“
(Jesus von Nazareth, Bd. 1, Einleitung)
Diese Begegnung – manchmal klar, manchmal tastend – soll hier mitschwingen. Mal als Cartoon, mal als Gedankensplitter, mal als leiser Kommentar zur Liturgie oder zu einem Evangeliumstext, mal als Frage wie: Hört Gott mich eigentlich? Oder: Wie bete ich, wenn mir nichts einfällt?

Kephas’ Frühstück
Kephas’ Frühstück, eine kleine Rubrik, die ich aus meinem alten Blog mitgenommen habe – ist mein Versuch, den Tag mit einem Schmunzeln und einem Impuls zu beginnen. Ein gezeichneter Gedanke, vielleicht auch mal nur ein liebevoll hingeworfener Satz.
Hier wird nicht viel über Wirtschaft oder Quantenphysik diskutiert. Spezialistentum liegt mir nicht. Dafür aber über das, was wirklich zählt: Wie man in einer frohen Gottesbeziehung leben kann. Mit viel Herz. (Herz Jesu, Herz Mariae…)
Ich wünsche mir, dass Kephas ein Ort wird, an dem man gerne vorbeischaut – wie in einer Küche, in der immer jemand ein offenes Ohr hat und vielleicht ein Stück frisch getoastetes Brot.
Diese Einladung Papst Franziskus’ gilt auch ab dem ersten Tag für die Leser und den Autor dieses Blogs:
Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen.
(Papst Franziskus, Evangelii Gaudium)
Du kannst gerne kommentieren, dich registrieren, mitdenken, mitfreuen. Und ja, ich bitte auch ein bisschen um den Vorschuss an Sympathie, den es braucht, damit hier etwas wachsen kann.
Neuss, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus, 29. Juni 2025
Bis bald,
dein Peter Esser (Kephas)